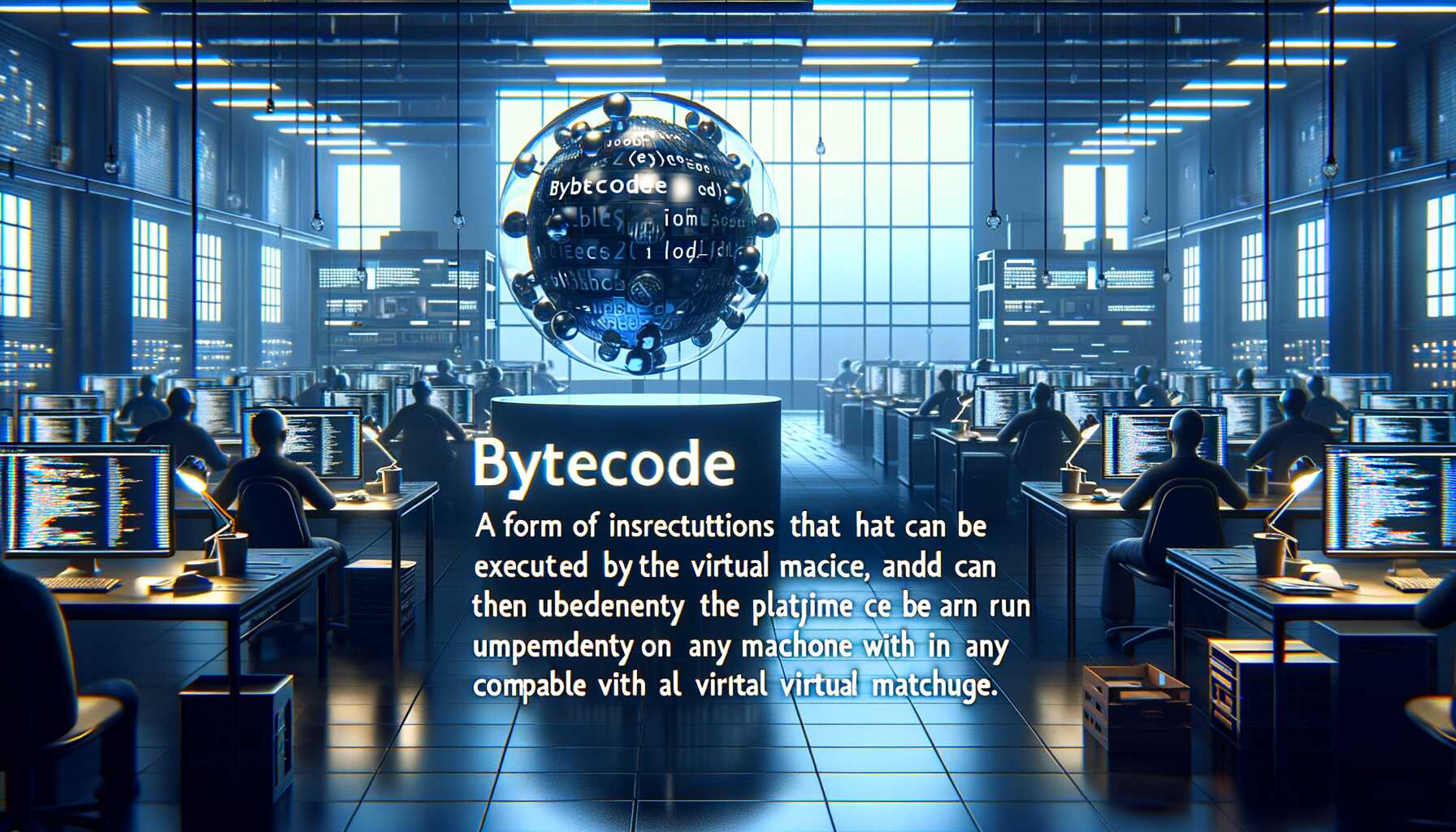Bytecode
Bytecode repräsentiert eine mittlere Ebene zwischen dem menschenlesbaren Quellcode und dem maschinennahen Code. Wenn Entwickler eine Anwendung in einer Hochsprache wie Java oder C# schreiben, wird der Quellcode zunächst von einem Compiler in Bytecode umgewandelt. Dieser Bytecode ist nicht direkt von einem Prozessor ausführbar, sondern muss von einer virtuellen Maschine, wie der Java Virtual Machine (JVM) oder der Common Language Runtime (CLR) bei .NET Framework, ausgeführt werden.
Der große Vorteil von Bytecode besteht darin, dass er plattformunabhängig ist. Das bedeutet, solange auf der Zielplattform die passende virtuelle Maschine verfügbar ist, kann der Bytecode ohne Änderungen ausgeführt werden. Dies bietet die Möglichkeit, Software zu entwickeln, die auf verschiedenen Betriebssystemen und Hardwarearchitekturen ohne die Notwendigkeit weiterer Anpassungen läuft. Auf diese Weise vereinfacht Bytecode die Softwareverteilung und -wartung wesentlich.
Bytecode wird zur Laufzeit von der virtuellen Maschine entweder direkt interpretiert oder durch einen Just-in-Time-Compiler (JIT) in maschinenspezifischen Code umgewandelt und ausgeführt. Die Interpretation ist flexibel, führt jedoch üblicherweise zu einer geringeren Ausführungsgeschwindigkeit als nativer Code. JIT-Compiler hingegen optimieren den Bytecode, indem sie ihn bei Bedarf in optimierten Maschinencode umwandeln. Durch diesen Vorgang kann die Performance verbessert werden, sodass die Ausführungsgeschwindigkeit häufig an die von nativ kompilierten Sprachen heranreicht.
Zusammenfassend ist Bytecode ein mächtiges Instrument in der Softwareentwicklung, das es ermöglicht, Anwendungen breit und einfach über verschiedene Systeme hinweg zu verteilen. Durch seine Eigenschaft der Plattformunabhängigkeit trägt er dazu bei, dass Softwareentwickler ihre Anwendungen einem größeren Publikum ohne aufwändige Portierungen zugänglich machen können.